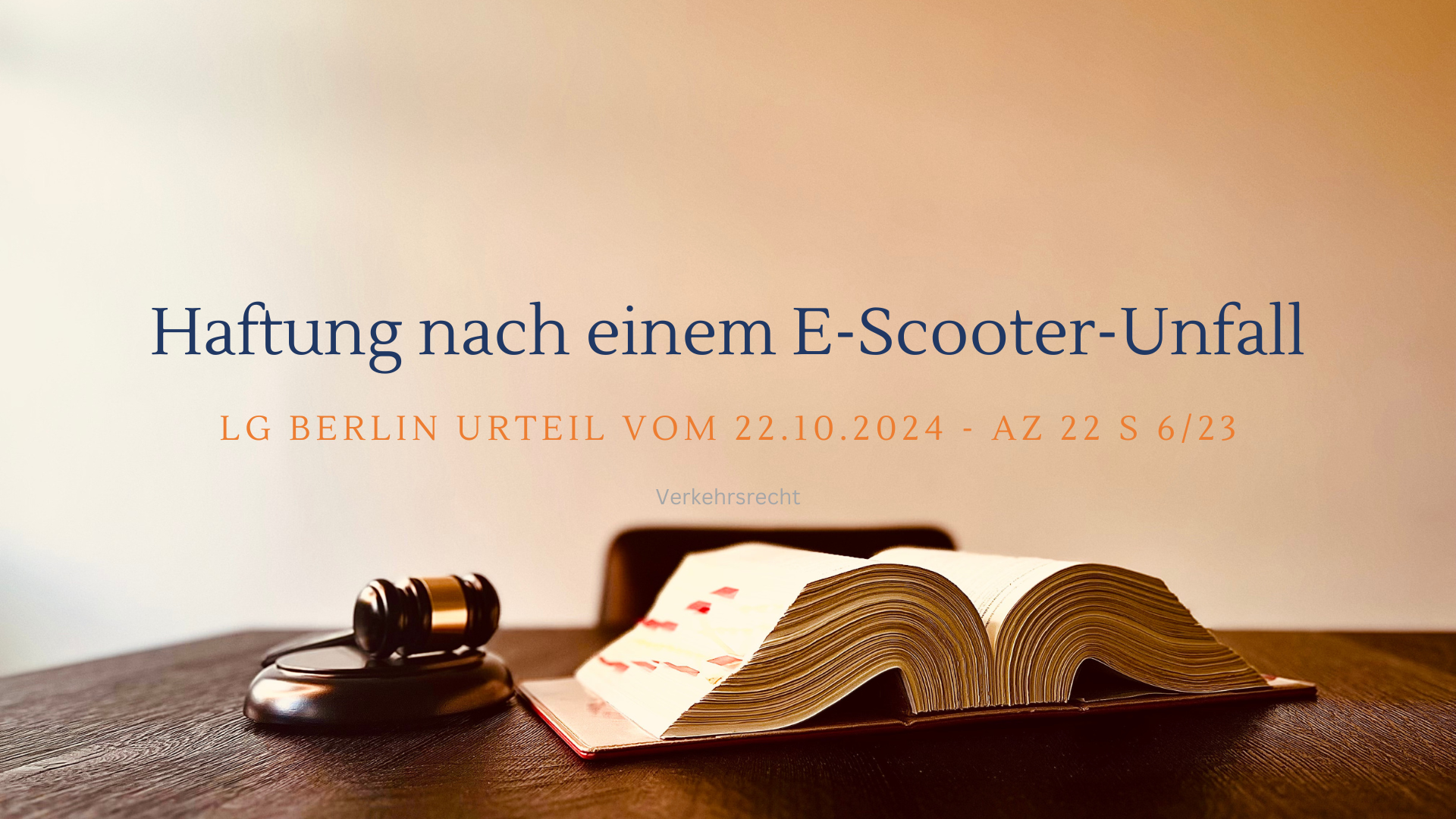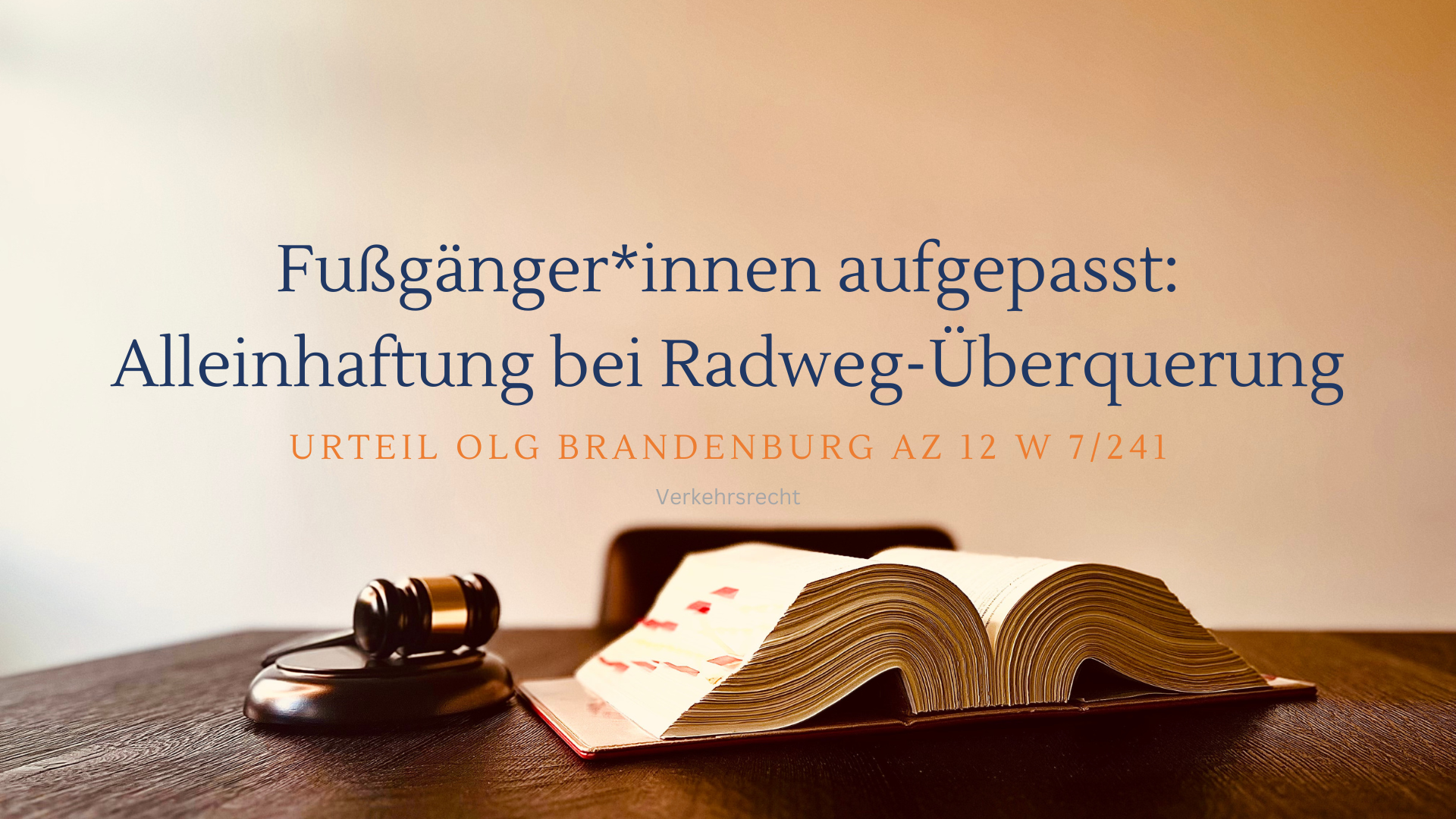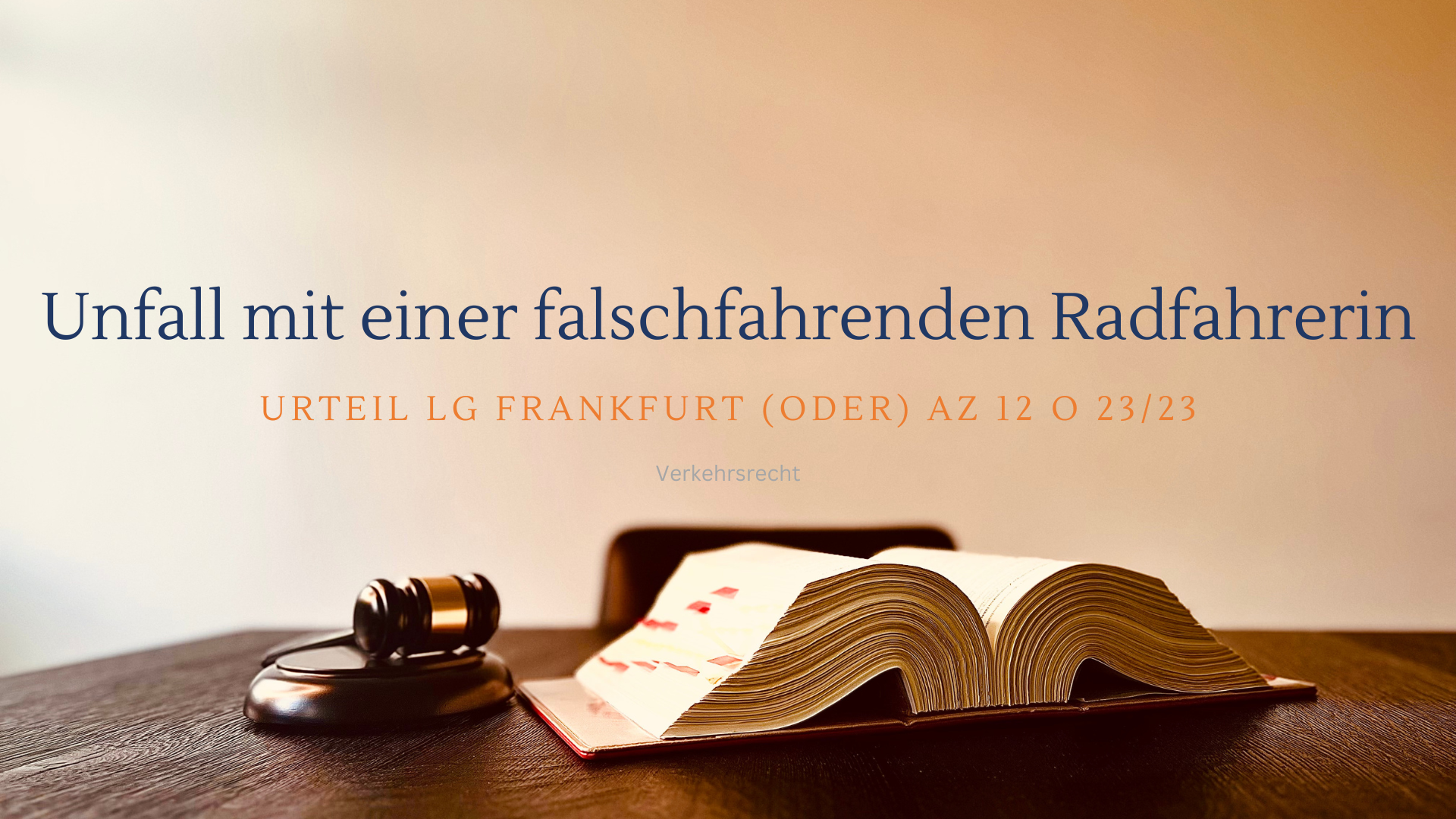Eigentumsverhältnisse an befruchteten Tieren Leihstute mit Embryo aus Fremdeigentum befruchtet: Wer wird Eigentümer des Fohlens?
Die frühere Eigentümerin hatte die Stute A sozusagen als „Leihmutter“ eingeplant, d.h. dem Pferd war der Embryo einer anderen Stute (der so genannten Spenderstute) eingesetzt worden. Nach einiger Zeit nahm die Züchterin aber an, dass die Empfängerstute A den Embryo verloren hatte. Sie verkaufte das Tier an Herrn L. Bald stellte sich heraus, dass die „Leihstute“ A doch trächtig war. Sie brachte später ein Hengstfohlen zur Welt.
Das Fohlen gehöre ihr, meinte die Eigentümerin der Spenderstute: Schließlich stamme von ihr der Embryo, also habe sie Anspruch auf das Hengstfohlen. Da Pferdekäufer L das anders sah, kam es zum Rechtsstreit. Die Halterin der Spenderstute verklagte L auf Herausgabe des Fohlens.
Eigentumsverhältnissen bei befruchteten Tieren
Zunächst stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Rolle Tiere in der Rechtsordnung einnehmen. Gemäß § 90a BGB sind Tiere keine Sachen. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften jedoch entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
Nach der Nidation wurde der Embryo wesentlicher Bestandteil der Stute iSd § 93 BGB.
Bestandteile einer Sache sind diejenigen körperlichen Gegenstände, die entweder von Natur aus eine Einheit bilden oder die durch die Verbindung miteinander ihre Selbständigkeit dergestalt verloren haben, dass sie fortan, solange die Verbindung dauert, als eine einzige Sache erscheinen. Maßgebend dafür ist die Verkehrsanschauung. Nach dieser wird eine befruchtete Stute wie eine einheitliche Sache behandelt.
Die Wesentlichkeit der Verbinung liegt vor, wenn die Bestandteile voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird. Dies ist bei der Leihstute und dem Embryo auch der Fall. Denn getrennt von der Empfängerstute hätte der Embryo nicht überleben können.
Gem. § 93 BGB kann der Embryo deshalb nach der Nidation nicht mehr Gegenstand besonderer Rechte sein, sondern der Embryo und die Leihstute werden wie eine einheitliche Sache behandelt.
Wer dann Eigentümer ist, bestimmt sich bei der Nidation nach § 947 BGB. So besteht gem. Abs. 1 bei einer Verbindung zwar grundsätzlich die Möglichkeit, dass die bisherigen Eigentümer Miteigentümer werden. Das gilt jedoch nicht, wenn eine Sache als Hauptsache anzusehen ist. Eine Hauptsache liegt vor, wenn die übrigen Bestandteile fehlen könnten, ohne dass das Wesen der Sache dadurch beeinträchtigt würde. Da die Leihstute weiterleben kann, auch wenn der Embryo abgestoßen wird, jedoch nicht umgekehrt, wird die Leihstute deshalb als Hauptsache angesehen. Der Eigentümer der Leihstute wird deshalb nach der Nidation gem. § 947 Abs. 2 BGB Alleineigentümer der befruchteten Leihstute (inklusive Embryo) sein. Nach der Trennung (in Form der Geburt) setzt sich das Eigentum an dem Fohlen als Erzeugnis der Leihstute dann gem. § 953 BGB fort.
Entscheidung des OLG
Aus diesem Grund scheiterte die Halterin der Spenderstute beim Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg mit seinem Anspruch auf Herausgabe: Herr L habe mit dem Kauf der Stute auch das Eigentum am Embryo und damit am Fohlen erworben. Der neue Eigentümer der Stute dürfe das Hengstfohlen behalten. Dass beim Vertragsschluss alle Beteiligten annahmen, die Stute sei nicht trächtig, ändere daran nichts.
Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Oldenburg vom 11.09.2024 – 8 U 36/24
- Von Marius Pflaum,
DIRO AG