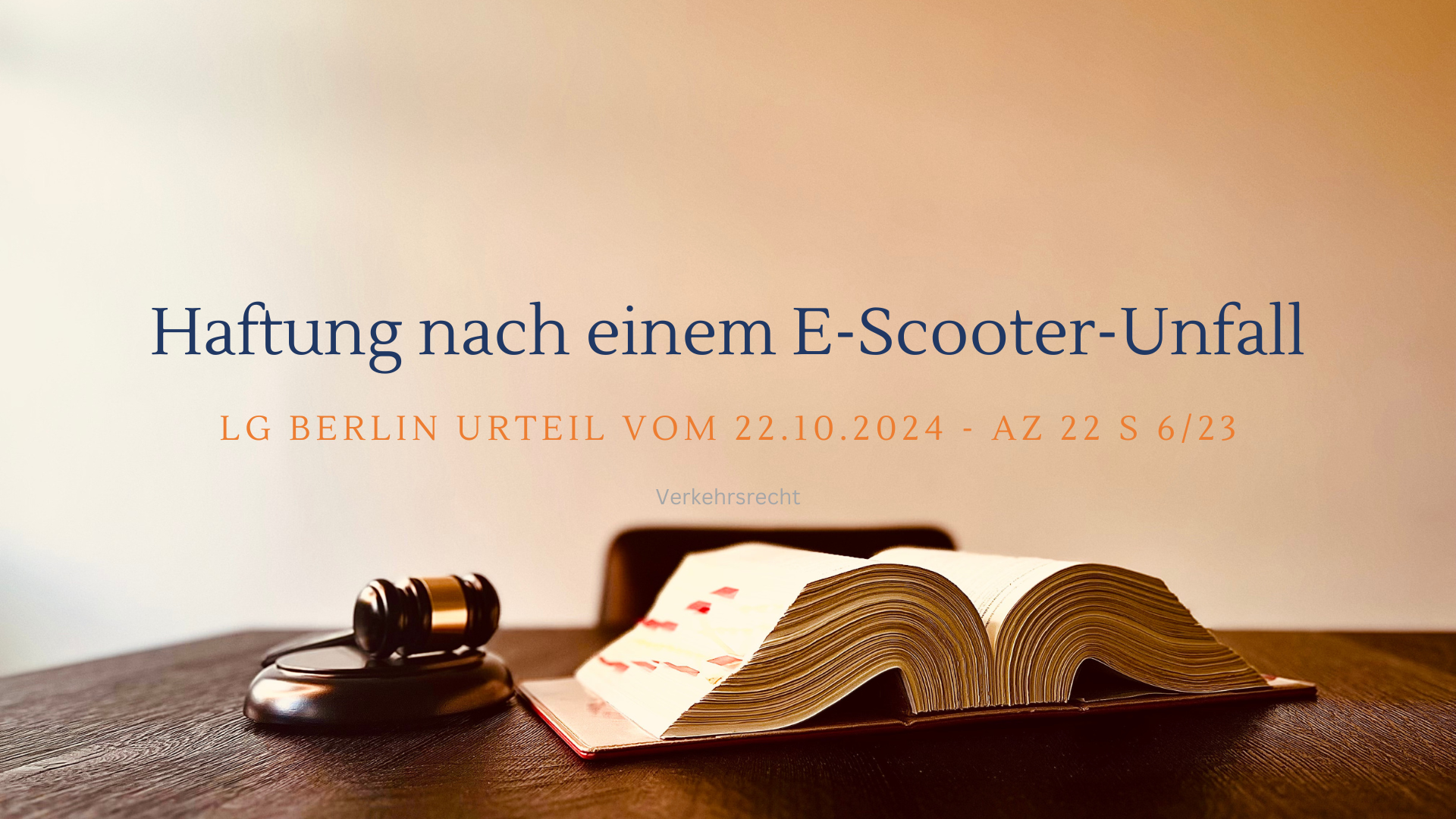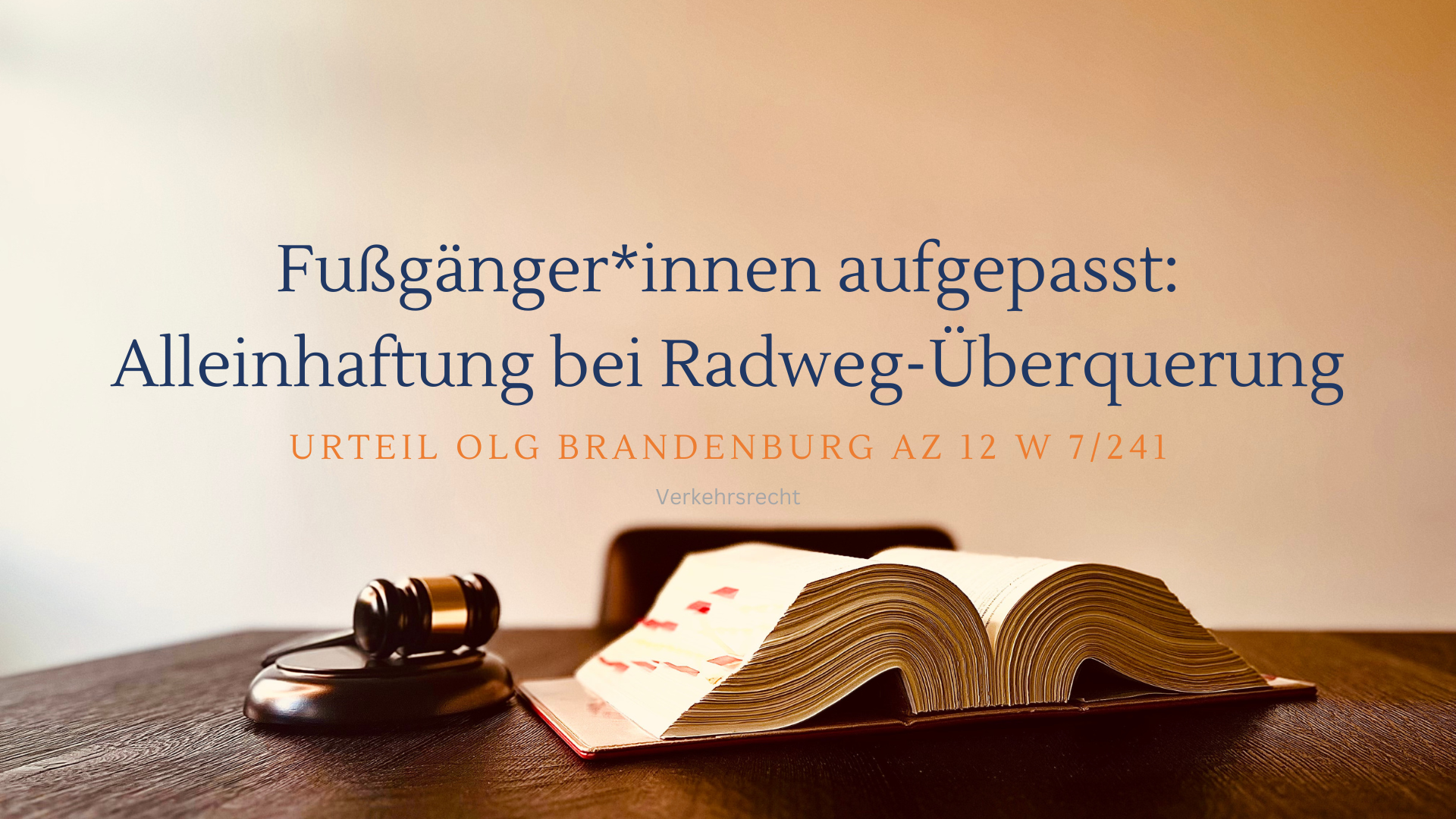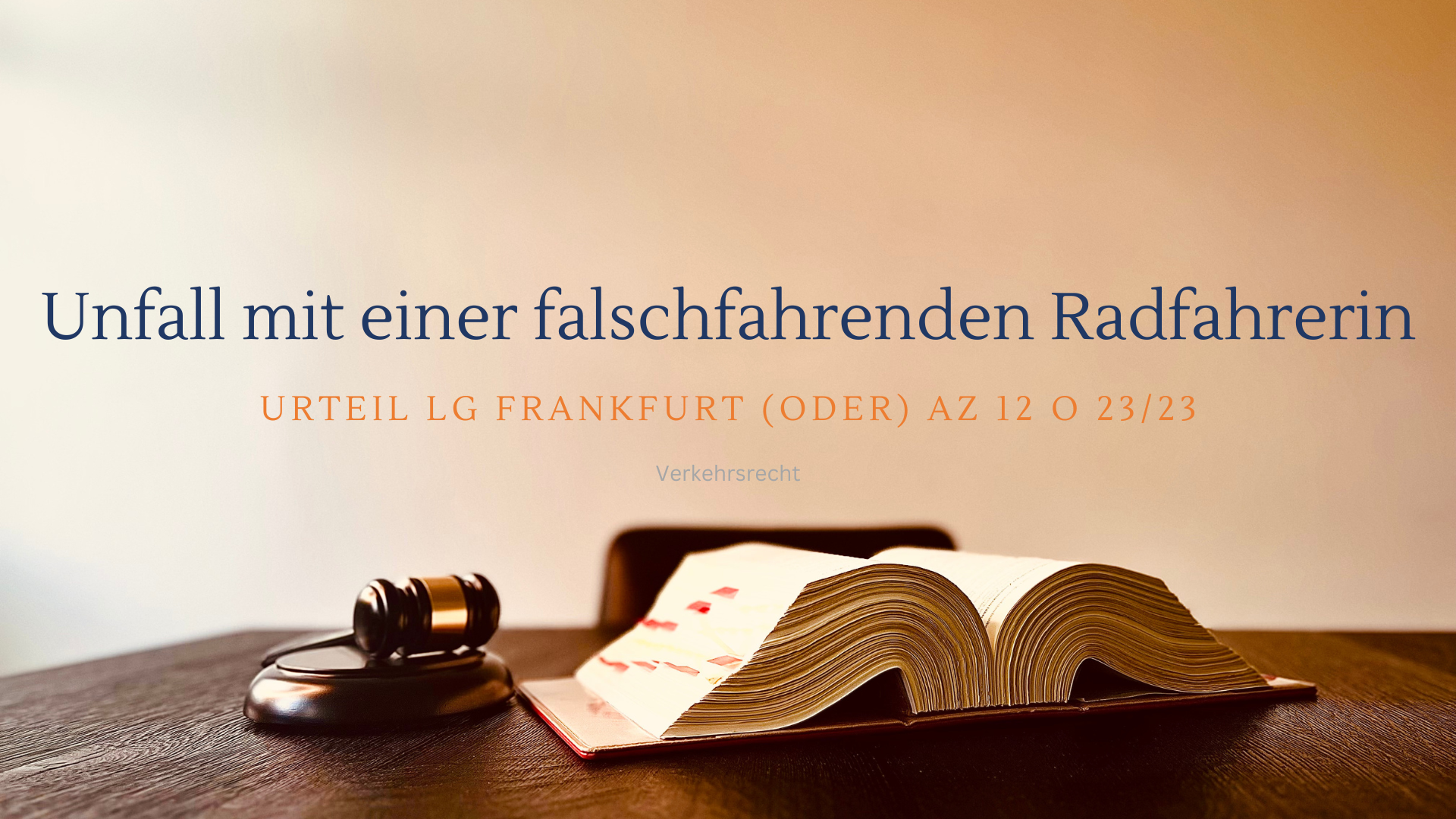Unfallversicherung Wegeunfall oder Privatangelegenheit? Gericht entscheidet über Tankstopp auf dem Arbeitsweg
Wegeunfälle sind ein zentraler Bestandteil des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes in Deutschland. Sie betreffen Unfälle, die sich auf dem direkten Weg zur oder von der Arbeitsstätte ereignen. Doch was passiert, wenn der Arbeitsweg unterbrochen wird, etwa durch einen notwendigen Tankstopp? In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob der Versicherungsschutz weiterhin besteht.
Ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Baden-Württemberg (Az. L 10 U 3706/21) beleuchtet genau diese Problematik:
Sachverhalt
Eine Auszubildende pendelte nahezu täglich mit ihrem Motorrad zu ihrer Ausbildungsstätte, die 18 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt lag. An einem Morgen stellte sie beim Starten fest, dass der Tank fast leer war – ihr Bruder hatte das Motorrad am Vorabend benutzt und dabei einen Großteil des Kraftstoffs verbraucht. Daher musste sie zunächst eine Tankstelle ansteuern.
Auf dem Weg dorthin wurde sie von einem Auto geschnitten, wodurch sie ausweichen musste und stürzte. Sie erlitt schwere Prellungen und war mehrere Wochen arbeitsunfähig. Ihren Antrag auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung lehnte die zuständige Berufsgenossenschaft ab. Begründet wurde dies damit, dass der gesetzliche Unfallversicherungsschutz nur für den direkten Arbeitsweg gelte. Ein Umweg zur Tankstelle sei nicht abgedeckt, da das Tanken im eigenen Interesse des Arbeitnehmers erfolge und nicht im betrieblichen Interesse. Folglich liege kein Arbeitsunfall vor.
Die Auszubildende erhob Klage gegen diese Entscheidung. Sie argumentierte, dass sie vor Fahrtantritt nicht gewusst habe, dass der Tank fast leer war. Daher habe sie keine andere Möglichkeit gehabt, als zur Tankstelle zu fahren, um überhaupt zur Ausbildungsstätte zu gelangen. Sie betrachtete die Tankfahrt als notwendige „Vorbereitungshandlung“ für ihre berufliche Tätigkeit.
Wegeunfälle
Unfälle auf dem Arbeitsweg, sogenannte Wegeunfälle, sind im deutschen Versicherungsrecht durch die gesetzliche Unfallversicherung geregelt. Die rechtlichen Grundlagen finden sich insbesondere im Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII).
Gemäß §8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII gilt der Versicherungsschutz für Unfälle, die sich auf dem unmittelbaren Weg zur oder von der versicherten Tätigkeit ereignen. Ein Wegeunfall liegt somit vor, wenn der Unfall auf dem direkten Weg zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte passiert. Dabei ist unerheblich, ob der Weg zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt wird.
Der Versicherungsschutz umfasst grundsätzlich nur den kürzesten und direktesten Weg. Nach §8 Abs. 2 SGB VII können jedoch Umwege unter bestimmten Voraussetzungen versichert sein, etwa wenn sie notwendig sind, um Kinder in eine Betreuungseinrichtung zu bringen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.
Allerdings erlischt der Versicherungsschutz, wenn der Arbeitnehmer den Weg zur Arbeit aus privaten Gründen verlässt. Er besteht erst dann wieder, wenn der Arbeitnehmer den ursprünglichen Arbeitsweg erneut aufnimmt. Dies gilt jedoch nur, sofern die Unterbrechung nicht länger als zwei Stunden andauert.
Entscheidung des LSG Baden-Württemberg
Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg (Az. L 10 U 3706/21) wies die Klage jedoch ab. Nach Auffassung des Gerichts zählt eine Fahrt zur Tankstelle nicht zum versicherten direkten Arbeitsweg. Auch wenn der Umweg erst während des Fahrtantritts erkennbar werde, sei er als privat motiviert einzustufen. Die Verantwortung für den Kraftstoffvorrat liege bei der Auszubildenden selbst, auch wenn Dritte – wie in diesem Fall der Bruder – das Fahrzeug genutzt hätten.
Das Gericht betonte, dass es Ausnahmen von dieser Regel gebe, etwa bei einem unvorhersehbaren Benzindiebstahl. In einem solchen Fall könne der Umweg zur Tankstelle unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung fallen. Ein Fehlverhalten des Bruders stelle jedoch keinen vergleichbaren Ausnahmefall dar. Andernfalls würde dies zu Ungleichbehandlungen führen: Vorausschauende Fahrer, die rechtzeitig tanken, benötigten keinen zusätzlichen Versicherungsschutz, während unaufmerksame Versicherte davon unverhältnismäßig profitieren würden.
Quelle: Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 26.09.2024 – L 10 U 3706/21
- Von Marius Pflaum,
DIRO AG